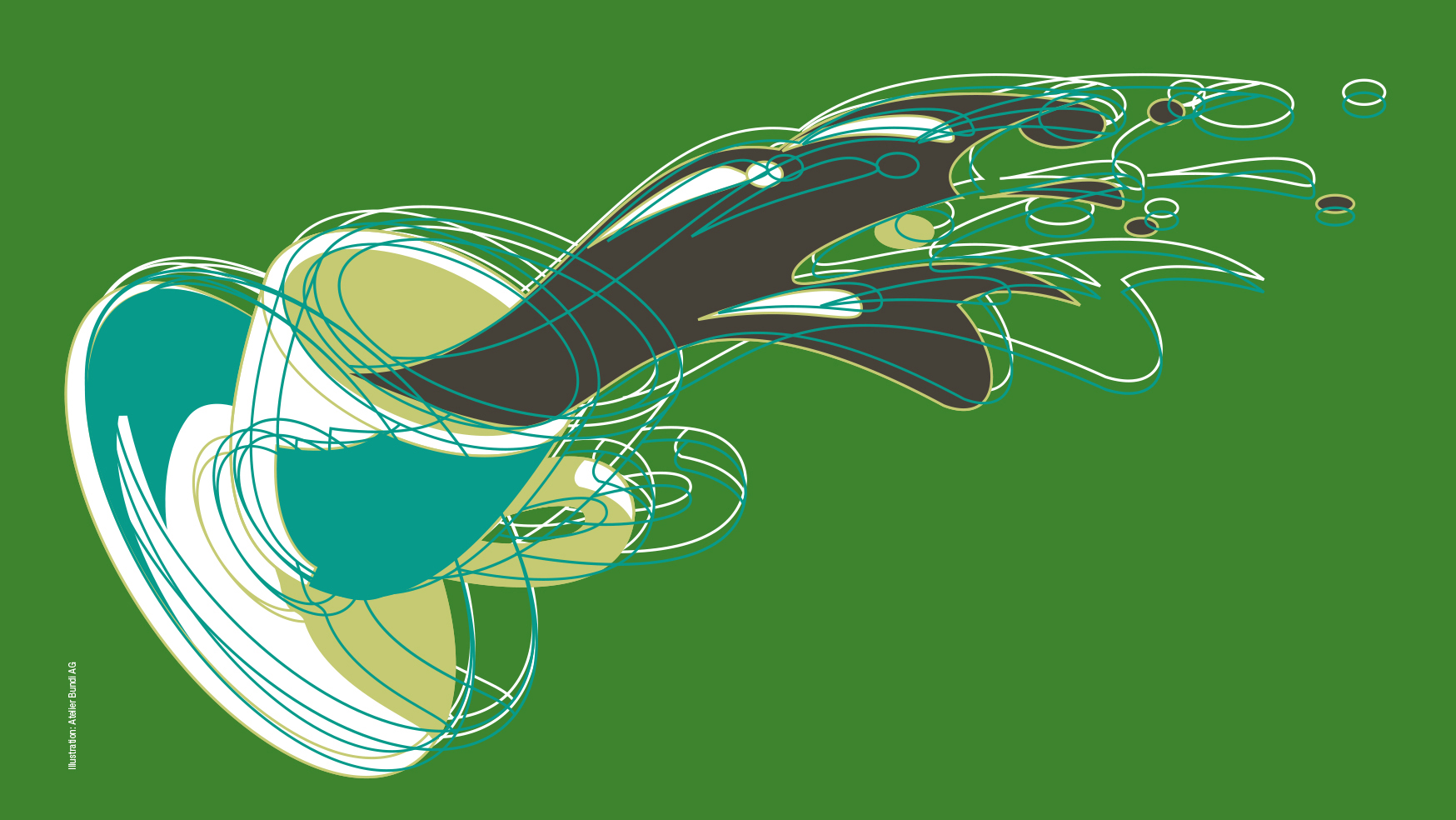Mia (12) sitzt zu Hause am Tablet und arbeitet an einer Lern-App, die ihr eine Freundin empfohlen hat. «Damit macht Nomen-Lernen richtig Spass», meinte diese kürzlich. Nach der Begrüssung erscheint auf ihrem Bildschirm die erste Aufgabe: «Setze das Nomen richtig ein.» Mia tippt: «Der junge läuft schnell.» Sofort erhält sie Feedback: «Denk an die Grossschreibung bei Nomen.» Sie korrigiert den Satz: «Der Junge läuft schnell» – und wird belohnt: Ein animierter Hund hüpft über den Bildschirm und verkündet: «Du bist eine Grammatik-Expertin!». Mia freut sich.
Ob Deutsch, Englisch oder Naturwissenschaften, ob Anfängerin oder Fortgeschrittener: Immer öfter greifen Lernende zu digitalen Apps. Sie versprechen einen raschen Lernerfolg, passen sich dem individuellen Lerntempo an und sind auf dem Smartphone oder Tablet jederzeit verfügbar. Viele Anwendungen setzen auf sogenannte Gamification, spielerische Elemente, die unser Belohnungssystem im Gehirn aktivieren und so unsere Freude und die Motivation, weiter am Ball zu bleiben, steigern.
Bestandteil eines modernen Schulunterrichts
Längst gehören Lern-Apps auch in den Schulen zum festen Bestandteil des modernen Unterrichts. Sie haben Namen wie Anton, Profax oder Geogebra. Weniger verspielt im Design, bieten sie Lehrpersonen die Möglichkeit, ihren Unterricht noch individualisierter zu gestalten. Schüler:innen können in ihrem eigenen Tempo und auf ihrem persönlichen Niveau arbeiten, Inhalte wiederholen oder sich an komplexeren Aufgaben versuchen.
Was bringen sie wirklich? Studie liefert Erkenntnisse
Doch fördern sie wirklich den Lernerfolg? Helfen sie Kindern und Jugendlichen, selbstständiger und zielgerichteter zu lernen? Und welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein? Forschende der Pädagogischen Hochschule Graubünden, der Universität Zürich, der Technische Universität München und der Universität Augsburg haben gemeinsam während zwei Jahren rund 35 internationale Studien über den Einsatz von digitalen Tools im Schulkontext in einer Metaanalyse vertieft ausgewertet. Untersucht wurden die Tools aus der Perspektive des selbstregulierten Lernens. Die Forschenden wollten unter anderem herausfinden, wie Kinder und Jugendliche ihren Lernprozess mithilfe der Tools auf ein Lernziel hin steuern und anpassen – also wie sie diesen planen, reflektieren, sich motivieren und mit Rückschlägen umgehen.
Bei den bisherigen Studien standen meist nur einzelne Apps oder Funktionen im Zentrum. «Wir wollten hingegen einen umfassenderen Gesamtüberblick über die Wirksamkeit verschiedener Tooltypen und deren Funktionen schaffen», sagt Prof. Dr. Francesca Suter, Leiterin der Professur Erziehungswissenschaften und Co-Leiterin der Studie. «Ziel der Untersuchung war es, besser zu verstehen, warum und unter welchen Bedingungen digitale Tools beim Lernen helfen». Die Ergebnisse liegen nun vor und werden erstmals am Wissenschaftscafé vom 2. Oktober in Chur vorgestellt.
Digitale Kompetenzen werden bereits im Kindergarten gefördert.
Kinder wie Mia lernen bereits im frühen Alter, digitale Tools zu bedienen und über den Umgang mit Medien, ihre Bedeutung und ihren Einfluss nachzudenken. So sieht es der Lehrplan 21 vor. Doch wie lernen Schüler:innen, sich bewusst mit Medien auseinanderzusetzen? Rico Puchegger, E-Learning-Experte und Dozent für Medien und Informatik an der PH Graubünden, beschäftigt sich mit dieser Frage. «Ob im Kindergarten oder in der Sekundarschule: Medienbildung bedeutet immer, Kinder und Jugendliche in ihrer Lebenswelt abzuholen. Das können neben analogen Medien auch Trickfilme, Computerspiele oder Lernsoftware sein. Lehrpersonen nutzen die Anknüpfungspunkte, um mit den Schüler:innen über Inhalte, Wirkung und eigene Haltungen zu sprechen. So wird schon früh ein Fundament für kritisches Denken im Umgang mit verschiedenen digitalen Medien geschaffen.» Mit zunehmendem Alter intensivieren und konkretisieren sich die Themen. «Auf höheren Schulstufen rücken Fragen wie Handyzeit, Social-Media-Nutzung, Onlineshopping oder faire Kommunikation im Netz ins Zentrum – Themen, die Kinder und Jugendliche direkt betreffen und über die sich Gespräche geradezu aufdrängen», so der Experte. Deshalb empfiehlt er nicht nur Lehrpersonen, sondern auch Eltern, sich aktiv mit digitalen Medien auseinanderzusetzen und regelmässig mit den Kindern darüber im Dialog zu bleiben.
KI – vom Fremdkörper zum Alltagswerkzeug
Nicht nur Lern-Apps verändern den Unterricht. Seit der Lancierung von ChatGPT im November 2022 verzeichnen Schulen eine rasante Zunahme entsprechender Softwares. Lernende setzen dabei zunehmend generative Machine-Learning-Systeme (GMLS) ein – umgangssprachlich als «künstliche Intelligenz» bezeichnet –, die sie als Unterstützung beim Lernen nutzen. In diesem Sinn lassen sich solche Anwendungen auch als eine neue Form von «Lern-Apps» verstehen. Interne Erhebungen an der PH Graubünden zeigen: Nutzte im ersten Jahr rund ein Fünftel der Studierenden täglich auf GMLS basierende Softwares, sind es heute bereits über 60 Prozent. Am häufigsten dienen sie beim Schreiben, Strukturieren von Aufgaben oder beim Verstehen neuer Themen. Wer darauf verzichtet, nennt vor allem mangelndes Vertrauen, fehlende Erfahrung oder die Kosten von Bezahlversionen.
Fazit für das Klassenzimmer
Für Lehrpersonen bedeutet dies: Lern-Apps und auf GMLS basierende Softwares können Lernprozesse individuell unterstützen, Aufgaben begleiten und zusätzliche Hilfestellungen bieten. Gleichzeitig ist es entscheidend, den Einsatz bewusst zu reflektieren und die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler im Umgang mit digitalen Lernmedien bewusst zu fördern.