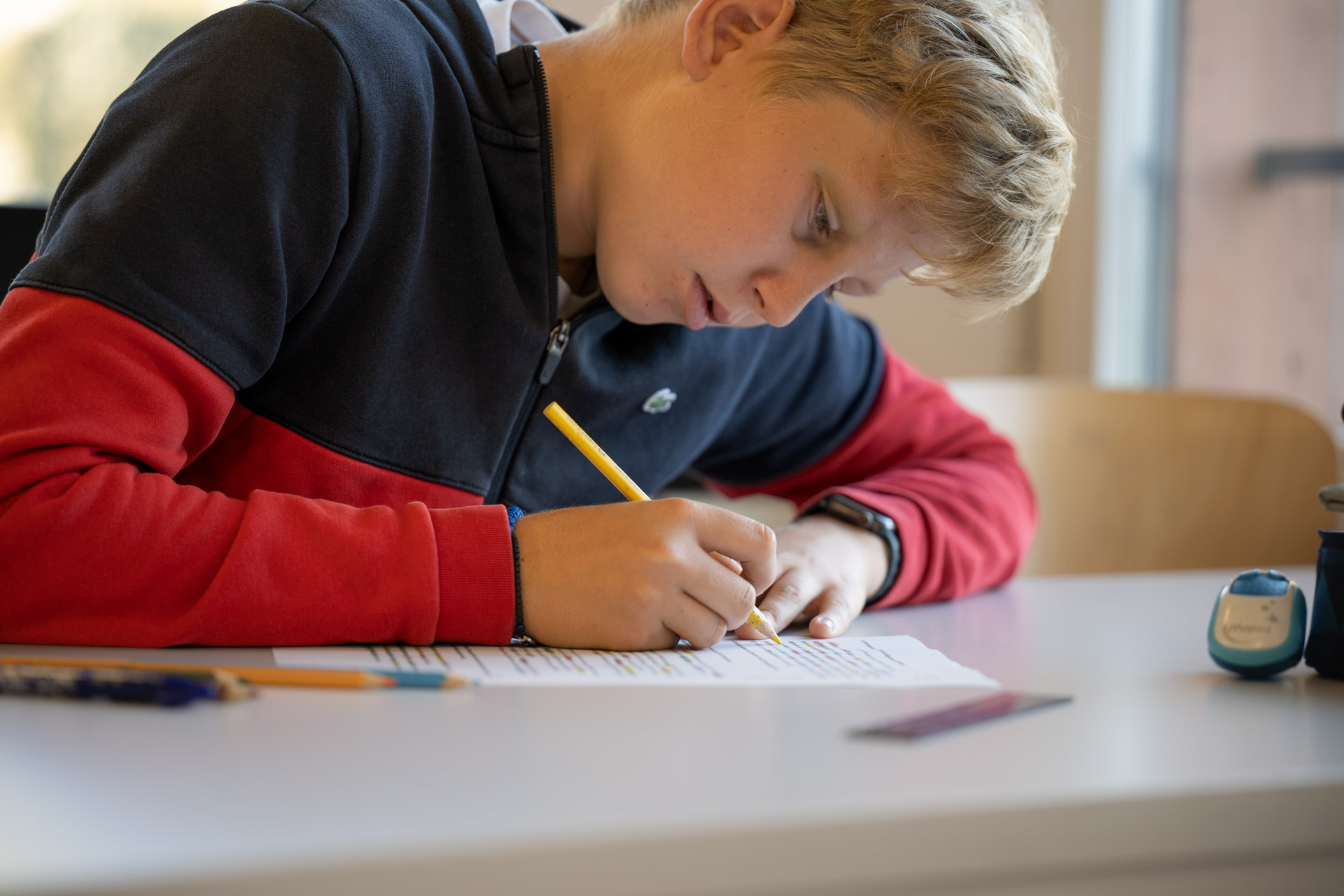Die Diskussionen rund um den schulischen Fremdsprachenunterricht entfachen in der Gesellschaft immer wieder aufs Neue. Dabei werden Kosten und Nutzen des fremdsprachlichen Unterrichts diskutiert, insbesondere die Belastung für die jungen Lernenden, die erreichten Lernziele und die Relevanz gewisser Fremdsprachen. Das Forschungsprojekt Modelli mentali dell’italiano L2 nella scuola elementare («Mentale Modelle zum Italienischen als Fremdsprache in der Primarschule», MoMIt) der Pädagogischen Hochschule Graubünden und der Universität Bern (August 2025 bis Januar 2029) widmet sich diesem Thema für den spezifischen Fall des Italienischen in Deutschbünden. Es wird Erkenntnisse zu den mentalen Modellen von Schülerinnen und Schülern, Erziehungsberechtigten und Lehrpersonen zum Italienischen als schulische Fremdsprache liefern.
Ein Projekt des Schweizerischen Nationalfonds zum Fach Italienisch in Deutschbünden
Ein internationales Forschungsteam unter der Leitung von Prof. Dr. Vincenzo Todisco (Professur für Italienisch und Italienischdidaktik an der Pädagogischen Hochschule Graubünden) und Prof. Dr. Silvia Natale (Institut für italienische Sprache und Literatur an der Universität Bern) erforscht das Thema der mentalen Modelle zum Italienischen als L2 in Graubünden seit dem Sommer 2025 im Rahmen des MoMIt-Projektes, das vom Schweizerischen Nationalfonds finanziert wird.
Einstellungen, Emotionen und Motivationen, die unter dem Begriff «mentale Modelle» subsumiert werden, spielen eine zentrale Rolle beim Lehren und Lernen von Fremdsprachen. Für das Italienische in der Schweiz liegen dazu bislang keine Studien vor.
Was wird erforscht?
Ziel der Studie ist es, herauszufinden, was die involvierten Akteurinnen und Akteure in Deutschbünden – Schülerinnen und Schüler, ihre Erziehungsberechtigten und die Italienischlehrpersonen – zum Thema «Italienisch als Fremdsprache» denken, welche Motivationen sie in Bezug auf das Schulfach Italienisch als Fremdsprache zeigen und welche Emotionen sie mit dieser Sprache verbinden. Dies wird in einem einzigartigen Kontext erforscht: Der deutschsprachige Teil des Kantons Graubünden ist eine Region, in der Italienisch als erste obligatorische Fremdsprache (noch vor dem Englischen) ab dem 3. Schuljahr unterrichtet wird.
Wie findet die Datenerhebung statt?
Das Forschungsteam wird die quantitativen Daten, die nötig sind, um die Forschungsfragen zu beantworten, im Schuljahr 2026/27 mittels Fragebogen bei freiwillig teilnehmenden Schülerinnen und Schülern der 6. Klassen Deutschbündens sowie bei deren Erziehungsberechtigten und Lehrpersonen erheben. Vorgängig werden in den drei Gruppen ausgewählte Gruppendiskussionen zum Italienischunterricht durchgeführt. Darüber hinaus nehmen die Schülerinnen und Schüler an einer schriftlichen (mittels eines C-Tests) und mündlichen (mittels einer Bildgeschichte) Aktivität teil.
Wozu dient die MoMIt-Studie?
Das SNF-Projekt MoMIt verfolgt das Ziel, ein vertieftes und wissenschaftlich fundiertes Bild des Italienischen als schulische Fremdsprache im deutschsprachigen Teil des Kantons Graubünden zu zeichnen. Dazu dienen die mentalen Modelle zum Italienischen als Fremdsprache von Lernenden, Erziehungsberechtigten und Lehrpersonen in Deutschbünden. Ferner sind die Forschenden an einer möglichen Korrelation zwischen den mentalen Modellen von Lernenden auf der einen Seite und von Erziehungsberechtigten und Lehrpersonen auf der anderen interessiert. Dazu meint Prof. Todisco: «Aus der Forschung ist bekannt, dass es nicht egal ist, wie Eltern, Lernende und Lehrpersonen über ein Fach denken. Wird die Sprache als wichtig oder eher als nutzlos erachtet? Wird sie als melodisch oder vielleicht als holprig wahrgenommen? Dies wiederum kann die Motivation der Kinder und letztendlich auch deren Lernfortschritt in der Fremdsprache beeinflussen.» Behandelt wird auch die Frage, inwiefern die mentalen Modelle dieser Akteure und Akteurinnen mit den Italienischkompetenzen von Schülerinnen und Schüler korrelieren. «Es besteht ein Zusammenhang zwischen der Motivation von Lehrpersonen und Lernenden auf der einen Seite und der Entwicklung der Kompetenzen der Lernenden auf der anderen: Das wurde schon mehrmals erforscht. Wir wollen überprüfen, ob dies auch im von uns untersuchten Fall zutrifft», fügt Todisco hinzu. «Die Lehrer:innenbildung kann auch davon profitieren, weil Erkenntnisse zur Rolle von Emotionen und Motivationen helfen können, den Unterricht effizienter zu gestalten.»
Dank der Resultate des Forschungsprojekts wird es möglich sein, den Dialog zwischen schulischer und familiärer Dimension zielgerichteter zu gestalten und das didaktische Angebot von Aus- und Weiterbildungen für (angehende) Italienisch- und andere Fremdsprachenlehrpersonen angemessen anzupassen. Das aus der Forschung gewonnene Gesamtbild des Italienischen und seiner Rolle innerhalb der schweizerischen Bildungslandschaft ermöglicht zudem den Vergleich mit ähnlichen Situationen von Minderheitensprachen ausserhalb der Schweiz. Dies wiederum wird die Diskussion über die Stellung von (Minderheiten-)Fremdsprachen in der Primarschule mit fundierten, wissenschaftlichen Daten bereichern.
Ein Kooperationsprojekt
Das SNF-Projekt MoMIt wird von der Pädagogischen Hochschule Graubünden und der Universität Bern geleitet. Als Projektpartner sind Forschende der Universitäten Fribourg (Prof. Dr. Raphael Berthele) und Radboud in den Niederlanden (Dr. Oana Costache) beteiligt.